#CONCEPT Der richtige Plan für Ihr Projekt.
Zielgerichtet zum Erfolg.
Wenn Sie auf dieser Seite angekommen sind, verfolgen Sie wahrscheinlich das Ziel, einen oder mehrere Ihrer Geschäftsprozesse zu automatisieren, um zusätzlichen Freiraum für Ihr Kerngeschäft zu schaffen.
Um Sie hierbei bestmöglich zu unterstützen, müssen wir zunächst verstehen, um welchen Ablauf es sich handelt und wie dieser bisher funktioniert. Zu diesem Zweck fertigen wir im ersten Schritt eine Ist-Analyse an, bei der wir auch den jeweiligen Kontext beleuchten (z.B. Branchen- und Unternehmensspezifika, Stakeholder, weitere Besonderheiten). In der anschließenden Soll-Analyse skizzieren wir das Zielszenario, innerhalb dessen der entsprechende Prozess fachlich neu gedacht und in zukunftssicherer IT abgebildet wird. So stellen wir sicher, dass alle IT-relevanten Aspekte wie Security, Organisation und Architektur einer einheitlichen Strategie folgen. Das geschieht auf Augenhöhe und unter regelmäßiger Abstimmung.
Gemeinsam mit Ihnen werden in dieser frühen Phase also bereits wichtige Entscheidungen getroffen, die den Ausgang des Projekts maßgeblich beeinflussen.

Das Ende im Blick. Von Anfang an.
Wir betrachten Einsatzzweck, Architektur, Hosting, Teilprozesse, Security und Code und erarbeiten einen Anforderungskatalog, mit dem wir die Weichen für den weiteren Weg stellen, das Ziel also fest im Blick haben.
Unsere Projektmanagement-Experten, die nicht nur klassische Methoden beherrschen, sondern vor allem in der agilen Welt zu Hause sind, stehen Ihnen während des gesamten Entwicklungsprozesses zur Seite.
Wir machen Ihre Sache zu unserer.
Unsere Business Analysten, Requirements Engineers und POs unterstützen Sie mit Erfahrung und Expertise. Sie verstehen die fachspezifischen Bedürfnisse Ihres Unternehmens, erfassen die Anforderungen genau und entwickeln im gemeinsamen Dialog kreative und individuelle Lösungen für Ihre Bedürfnisse.
Unsere CONCEPT-Leistungsbereiche
Governance
An IT-Systeme werden bestimmte gesamtunternehmerische Erwartungen gestellt, die erfüllt werden müssen. In erster Linie geht es hierbei um Anforderungen im Bereich der (Prozess-)Organisation, des Datenschutzes und der IT-Security. Wir berücksichtigen diese Themen bereits in der Konzeptphase.
Projektmanagement
Wir waren schon agil, bevor es zum Buzzword wurde und sprechen fließend Scrum. Neben zahlreichen Kundenprojekten ist auch unser beliebtes Scrum-Plakat ein Beispiel für unsere Expertise. Klassische PM-Methoden gehören ebenfalls zum Skillset unserer Berater.
Requirements Engineering
Requirements Engineering meint die Ermittlung, Analyse und Spezifikation aller Anforderungen, die für die Entwicklung einer Software nötig sind. Wohl definierte Requirements und ein Überprüfen derselben im agilen Entwicklungsprozess sind essenziell für den Projekterfolg und sorgen für eine hohe Ergebnisqualität.
UI/UX
Gute Software braucht mehr als nur ein starkes Backend. Knackiges Design und intuitives Handling sind die halbe Miete. Wir liefern das gesamte Paket, zu dem in dieser ersten Projektphase auch ein sinnvolles und stimmiges Design- und Bedienungskonzept zählt.

Elke ist Teil des Concept-Teams. Sie und ihre Kolleginnen und Kollegen helfen Ihnen an dieser Stelle weiter.
Die Vorteile unserer CONCEPT-Arbeit
- Durchdachtes Konzept für jede Phase des C⁴-Frameworks
- Gemeinsame und detaillierte Aufnahme der Requirements für eine Umsetzung im agilen Projektsetting
- Erweiterung des Lösungsraums, um die eigene Vorstellung durch die Außenperspektive zu durchbrechen
- Projektmanagement, das Ihr Projekt zuverlässig und mit Qualität ins Ziel bringt

Wie wir Leistungen erbringen
Inhouse-Projekt
Als eingespieltes Team übernehmen wir die Gesamtverantwortung Ihres IT-Projekts und liefern eine maßgeschneiderte und schlüsselfertige Lösung – so stellen wir sicher, das Projekt in die richtigen Bahnen lenken zu können.
Consulting
Hierbei unterstützen wir Sie in Ihrem IT-Projekt an der richtigen Stelle und Entsenden ausgewiesene Experten dorthin, wo sie gebraucht werden – zum Beispiel im Zuge des Requirements Engineerings.
Unsere Cases
Unsere Technologiepartner





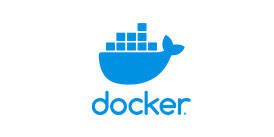






Das sagen unsere CONCEPT-Künstler

Moritz

Elke

Alina
„Warum iF”?
Softwareentwicklung können viele. Auf diese Details achten aber nur wenige.
1
Mutige Kundenversteher
Wir hören zu, präsentieren jedoch auch unsere Sicht auf die Dinge, um den für Sie richtigen Weg einzuschlagen. Das ist ab und an unbequem und führt gleichzeitig zum Ziel.
2
Situationsunabhängig unkonventionell
Wir folgen nicht blind jedem Trend, sondern wählen den individuell optimalen Lösungsweg, was nicht immer dem Usus entspricht.
3
Fokus auf Requirements
Die Anforderungen bestimmen den Ausgang des Projekts. Hier gehen wir tief ins Detail. Eben Ende zu Ende – von Anfang an.
4
Partner auf Augenhöhe
Wir verstehen uns als Partner, der den gemeinsamen Erfolg als oberstes Ziel priorisiert. Partner sagen sich offen, wenn etwas nicht passt. Der Teamgedanke spielt für uns eine integrale Rolle.
5
Hohe Qualität als Anspruch
Zentraler Baustein unserer Leistungserbringung. Wir liefern hohe Qualität in allen Phasen des C⁴-Frameworks, für ein Ergebnis, das den Erwartungen entspricht.
CONCEPT im Lifecycle entdecken

Kontaktieren Sie uns
Noch Fragen?
Wir sind für Sie da. Schreiben Sie uns jederzeit über unser Kontaktformular – oder melden Sie sich via E-Mail oder Telefon direkt bei uns.
